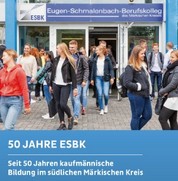Berufsorientierung
Die Möglichkeiten, die sich nach Abschluss der Höheren Handelsschule mit dem Fachabitur bieten, sind sehr vielfältig. Das große Spektrum der kaufmännischen Ausbildungsberufe steht den Absolventinnen und Absolventen ebenso offen wie das Studium an einer Fachhochschule. Vielen Schülerinnen und Schülern fehlt hier der Überblick; weit verbreitet ist bei ihnen auch die Sorge, beruflich die falsche Entscheidung zu treffen. Mit dem Fach Berufsorientierung verfolgt das Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg das Ziel, die Schülerinnen und Schüler bei der Wahl eines geeigneten Berufs zu unterstützen und sie zu befähigen, sich im Anschluss an das Fachabitur eine ihren Leistungen und Interessen entsprechende berufliche Existenz aufzubauen.
Der Berufsorientierungsunterricht unterstützt den Prozess der Berufswahl durch eine Reihe von schulischen und außerschulischen Maßnahmen. Dazu gehört im Rahmen des schulischen Unterrichts die gezielte Auseinandersetzung mit verschiedenen kaufmännischen Ausbildungsberufen und deren Anforderungen sowie mit den sich bietenden Studienmöglichkeiten an Fachhochschulen. Ein Berufseignungstest, der Besuch einer Ausbildungsmesse in der Region und die Vorbereitung des Berufsorientierungspraktikums in Klasse 11 sind weitere Bausteine des Berufsorientierungsunterrichts, die zu einer größeren Sicherheit bei der Entscheidung für den beruflichen Lebensweg führen sollen. Ein weiterer Schwerpunkt des Fachs liegt schließlich bei der intensiven Vorbereitung auf die Bewerberauswahlverfahren von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Im Unterricht wird daher an der Verbesserung der schriftlichen Bewerbung ebenso gearbeitet wie an der Frage, was zu einem überzeugenden Auftritt in Vorstellungsgesprächen gehört. Die Maßnahmen werden komplettiert durch die unterrichtliche Vorbereitung auf Einstellungstests sowie ein in Kooperation mit der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) durchgeführtes Assessmentcenter-Training.
Religionsunterricht
Evangelischer und katholischer Religionsunterricht in der HöHa
Evangelischer und katholischer Religionsunterricht sind ein wesentlicher Ort im Schulalltag, an dem Schülerinnen und Schüler ihre eigene Identität und ihre Rollen in Beruf und Gesellschaft, aber auch in ihrem privaten Umfeld reflektieren können. Dabei kommen für sie lebensbedeutsame Fragen in den Blick: Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wozu das Ganze? Was ist richtig, was falsch? Wie soll ich mich verhalten? Hier schafft der Religionsunterricht einen Raum für offene Kommunikation über unterschiedliche Weltdeutungen und Wertüberzeugungen und bietet an, sich mit dem christlichen Glauben als Orientierung auseinanderzusetzen. Zukünftige berufliche und private, oft belastende und mit Leiderfahrung geprägte Situationen kommen zur Sprache. Werte wie Personalität, Solidarität, Gerechtigkeit und Verantwortung werden auf ihre Tragfähigkeit für ein zukunftsorientiertes Leben untersucht. Durch das gemeinsame Handeln fördert der Religionsunterricht Teamarbeit, Kooperationsbereitschaft und Fairness, Mut zu selbständigen Entscheidungen und Kritikfähigkeit.
Viele der Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht teilnehmen, sind haben keinen Bezug mehr zur Kirche und sind nicht mehr konfessionell sozialisiert. Oft haben sie unreflektierte religiöse Vorstellungen, die sie als junge Erwachsene ablehnen. Darum wollen sich die Religionslehrer mit ihnen gemeinsam altersgemäß und kritisch mit der Botschaft des christlichen Glaubens und seinen zentralen Inhalten auseinandersetzen. Dabei geht es aber nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch um die Sensibilisierung für Religion und Spiritualität.
Besonders durch das Gespräch mit Schülern anderer Konfessionen und Religionen, die als Gäste eingeladen sind am Religionsunterricht teilzunehmen, können Schülerinnen und Schüler lernen, andere Standpunkte und Entscheidungen zu tolerieren, zu akzeptieren und Perspektivwechsel vorzunehmen. Damit fördert der Religionsunterricht insbesondere das Zusammenleben mit anderen und sich für elementare Menschenrechte, wie Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit einzusetzen. Darüber hinaus will er den Blick für die „Eine Welt“ öffnen und Schülerinnen und Schüler ermutigen, sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzusetzen.
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
Mit einem Umfang von sechs Unterrichtsstunden je Woche gehört das Fach Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen (BWR) am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg (ESBK) zu den wichtigsten Fächern der Höheren Handelsschule. Im Mittelpunkt des Fachs BWR stehen betriebswirtschaftliche Überlegungen und Abläufe in Unternehmen sowie das zielorientierte, planvolle und rationale Handeln von Menschen in Unternehmen. Konkret geht es im Fach BWR darum, Unternehmen als Marktteilnehmer zu interpretieren und zu verstehen, wie deren Marktanbindung sowohl zu spezifischen Organisationslösungen als auch zu spezifischen innerbetrieblichen Prozessen führt. Betriebswirtschaftliche Konzepte können dabei Zweifaches leisten: Auf der einen Seite können rationale Handlungen vorgenommen werden. Dies führt insbesondere zur Erklärung ökonomischer Prozesse und Entscheidungen. Auf der anderen Seite sollen ökonomische Strukturen und Prozesse dokumentiert werden. Dies etabliert Rechnungswesen – Buchführung und Kosten- und Leistungsrechnung – als Dokumentationssystem.
Das Fach BWR wird als Fach des fachlichen Schwerpunktes dem berufsbezogenen Lernbereich zugeordnet. Die Schülerinnen und Schüler erwerben im Fach BWR die Fähigkeit, sich zu betriebswirtschaftlichen Problemstellungen eine begründete Meinung zu bilden und Lösungsansätze zu entwickeln. Dabei modellieren sie betriebswirtschaftliche Entscheidungen in Abhängigkeit von unternehmerischen Zielsetzungen und der Zielsetzungen unterschiedlicher Interessengruppen. Die Schülerinnen und Schüler erlangen die Fähigkeit und Bereitschaft, die ökonomische Wirklichkeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen. Dazu zählt auch die Fähigkeit, unterschiedliche Argumentationsansätze nachzuvollziehen, in denen sich konkrete ökonomische Interessen äußern, diese Ansätze voneinander zu unterscheiden sowie die jeweiligen Interessenlagen und Werteorientierungen zu analysieren und zu beurteilen.
Englisch
Der Leitgedanke unserer Arbeit im Fach Englisch in der Höheren Handelsschule besteht in der folgenden Aussage:
„Das Berufskolleg vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine umfassende berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungskompetenz und bereitet sie auf ein lebensbegleitendes Lernen vor. Es qualifiziert die Schülerinnen und Schüler, an zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft teilzunehmen und diese aktiv mitzugestalten.“ (siehe Bildungsplan des Faches)
Ziel der Bildungsgänge der Höheren Berufsfachschule ist somit der Erwerb umfassender Handlungskompetenzen im Rahmen eines sowohl beruflich wie auch wissenschaftlich orientierten Bildungsprozesses. Die Höhere Berufsfachschule vermittelt Kompetenzen, die das selbstständige, fachliche Arbeiten in breit gefächerten beruflichen Tätigkeitsfeldern in Wirtschaft und Verwaltung bzw. entsprechenden Studiengängen ermöglichen. Im Vergleich zum Mittleren Schulabschluss ist es in der fortgeführten Fremdsprache Ziel der Höheren Berufsfachschule, die Niveaustufe B2 (‚Vantage’) zu erreichen; das bedeutet den Erwerb einer gehobenen Kommunikationsfähigkeit. Der Englischunterricht in der Höheren Berufsfachschule soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrer Zukunft an international geprägten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen teilnehmen können. Die Aufgaben und Ziele des Faches Englisch ergeben sich aus der Verwendung der englischen Sprache als Handels- und Verkehrssprache in weiten Bereichen der internationalen Kommunikation, sowohl in beruflichen wie außerberuflichen Situationen. Den Kompetenzen der Rezeption, Produktion, Mediation und Interaktion im beruflichen Bereich Wirtschaft und Verwaltung kommt eine besondere Bedeutung zu; Englisch wird nicht nur in der Kommunikation im privaten Bereich benutzt, sondern auch in Beruf und Studium. Die Fähigkeit der Rezeption umfasst die Kompetenz, Texte der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung hörend und lesend zu verstehen. Rezeption bedeutet das Verstehen des gehörten und des gelesenen Wortes und schließt audio-visuell präsentierte Materialien mit ein. Produktion bedeutet das Erstellen von mündlichen und schriftlichen Mitteilungen aller Art. Die Fähigkeit der Interaktion meint die Kompetenz zum Führen von Gesprächen und den Austausch von Mitteilungen. Die Fähigkeit der Mediation bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler in zweisprachigen Situationen vermitteln können. Im Einzelnen beschreibt Mediation das Übertragen von Mitteilungen, Texten, Gesprächen usw. von einer Sprache in die andere (Englisch – Deutsch bzw. Deutsch – Englisch). Die Entwicklung der kommunikativen Kompetenzen bezieht sich auf die folgenden Bereiche:
- Wortschatz,
- Grammatik,
- Aussprache und
- Rechtschreibung.
Ein wesentliches Ziel des Englischunterrichts in der Höheren Berufsfachschule ist nicht zuletzt, Kenntnisse über ökonomische, gesellschaftliche, politische und kulturelle Gegebenheiten englischsprachiger Länder zu erwerben, die dazu beitragen, in beruflichen und privaten Situationen angemessen und zielgerichtet zu agieren. Interesse für die Fremdsprache und die Kultur englischsprachiger Länder im allgemeinen zu wecken, bleibt eine grundlegende Aufgabe des Englischunterrichts. Das ständige Bemühen, dieser Herausforderung gerecht zu werden, erweitert nicht nur die interkulturelle Kompetenz und den Horizont der Jugendlichen, sondern unterstützt auch deren Selbstfindungsprozess und die Entwicklung von Toleranz.
Politik und Gesellschaftslehre
Oberstes Ziel des Lernens im Fach Politik/Gesellschaftslehre ist es, Schüler und Schülerinnen zur Mündigkeit in der Gesellschaft zu führen. Mündigkeit erfordert vom Einzelnen, ein entsprechendes Verfügungswissen herauszubilden und umfasst die Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung für die eigene Lebensplanung und die Bereitschaft zum Engagement in der Gesellschaft, das heißt einen verantwortlichen Umgang mit wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten und den natürlichen Ressourcen. Mündigkeit ist aus der Sicht des Einzelnen eine Bedingung für erfolgreiche Partizipation, sie ist aber auch für die Erhaltung und Weiterentwicklung einer demokratischen politischen Kultur eines demokratischen Systems unverzichtbar.
Gesellschaftslehre unterstützt die Schüler und Schülerinnen dabei, sich Kenntnisse über geschichtliche Entwicklungen, geographische Bedingungen und politische Strukturen anzueignen, und befähigt sie, ihre Lebenswelt zunehmend selbstständig zu erschließen, sich in ihr zu orientieren und sie mitzugestalten. Sie erkennen das friedliche Miteinander von Völkern und Staaten als unverzichtbare Voraussetzung auch für ihr eigenes Leben an und entwickeln die Fähigkeit, sich in das Denken und die Probleme von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen hineinzuversetzen.
In Gesellschaftslehre erwerben, erweitern und vertiefen Schülerinnen und Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel, die Welt in ihren Wechselwirkungen zwischen historischen, geographischen und politischen Entwicklungen zu verstehen. Verantwortliches Handeln setzt dabei in gleicher Weise Kenntnisse historischen Wandels und kulturräumlicher Entwicklung sowie Kenntnisse politischer Strukturen sowie einen kritischen Umgang mit Medien voraus.
Kern des Fachs ist die Vermittlung bzw. Erarbeitung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und geschichtlichen Grundlagen. Dabei werden Themen von individueller Bedeutung bis zu globalisierten Welt behandelt, d. h. Fragen wie:
- Auf welcher Grundlage funktioniert die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland?
- Wie hat sich das gesellschaftliche Leben weiter entwickelt?
- Welche Anforderungen hat die Berufswelt an den Einzelnen?
- Welche Lösungsansätze gibt es für das Problem sozialer Ungerechtigkeit?
- Welche Chancen und Risiken bietet die globale Vernetzung?
- Wie geht die Gesellschaft bzw. die Politik mit der wechselseitigen Abhängigkeit von Ökonomie und Ökologie um?
- Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit von Staaten auf europäischer und auf globaler Ebene?
Politik und Gesellschaftslehre wird dabei wöchentlich zweistündig angeboten. Die Leistungsüberprüfung erfolgt dabei, wie an der Schule üblich, durch eine Mischung aus zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr und weiteren Leistungen, die auf verschiedenen Wegen erbracht werden können.
Französisch, fortgeschritten
Die Bedeutung der französischen Sprache lässt sich in mehrfacher Hinsicht erklären. Einerseits ist sie Mutter – und Amtssprache in vielen Ländern der Welt, andererseits stellt sie neben Englisch die zweite Arbeitssprache der Europäischen Union und der Vereinten Nationen dar. Schließlich ist sie die Sprache des wichtigsten deutschen Handelspartners: Frankreich.
Französisch wird in der Höheren Handelsschule als fortgeführte Fremdsprache erteilt. Neben dem Erwerb eines grundlegenden Wortschatzes werden wichtige grammatische Strukturen erarbeitet und vertieft.
Die Schüler(innen) sollen mit französischer Landeskunde vertraut gemacht werden, wirtschaftliche Kenntnisse über Frankreich und seine Überseegebiete erwerben sowie vor allem die Umgangssprache anhand typischer Alltagsituationen erlernen. Neben der gesprochenen Sprache kommt der Handelskorrespondenz eine besondere Bedeutung zu. Beginnend mit privatem Schriftverkehr und halboffiziellen Schreibensollen die Schüler(innen) die Grundzüge des kaufmännischen Schriftverkehrs in mündlicher wie in schriftlicher Form erlernen. Eine Fertigkeit, die für ein so exportorientiertes Land wie Deutschland von großer Bedeutung ist.
Volkswirtschaftslehre

Was ist Volkswirtschaftslehre?
Während die Betriebswirtschaftslehre den Erfolg des einzelnen Unternehmens in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt, legt die Volkswirtschaftslehre ihren Fokus auf das ganzheitliche wirtschaftliche Handeln und die Rolle all jener, die am Wirtschaftsprozess beteiligt sind. Dazu zählen neben den Unternehmen auch die Menschen, die in einer Volkswirtschaft leben, ebenso wie die Banken, der Staat, das Ausland, sowie die Europäische Union. Einen zentralen Aspekt stellt hier die Frage dar, wie diese durch ihr Handeln unsere Wirtschaft mitgestalten.
Typische Fragestellungen aus volkswirtschaftlicher Sicht sind zum Beispiel:
- Was bedeutet wirtschaften?
- Warum ist es notwendig, wirtschaftlich zu handeln?
- Welche Rolle spielen die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer?
- Was ist ein Markt?
- Welche wirtschaftlichen Probleme treten auf, wie z.B. Geldwertstörungen oder Arbeitslosigkeit?
- Welche Funktionen übernehmen öffentliche Institutionen wie z.B. der Staat oder die Europäische Zentralbank?
- Welche Rolle spielt die zunehmende Globalisierung der Märkte?
- In welcher Wirtschaftsordnung leben wir?
- Wie sollte eine nachhaltige Wirtschaft aussehen?
Ziel des Unterrichts im Fach Volkswirtschaftslehre ist es unter anderem, die Inhalte problemorientiert und selbstgesteuert zu erarbeiten, um so eine Verbindung von Theorie und realem Leben herzustellen. Die Schülerinnen und Schüler finden sich in der Rolle als Wirtschaftsteilnehmer wieder und setzen sich mit der Fragestellung auseinander, wie sie selbst am Wirtschaftsprozess beteiligt sind und wie sie diesen durch ihr individuelles Handeln beeinflussen. Hier stehen insbesondere Aspekte wie Leistungsbereitschaft, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung im Vordergrund.